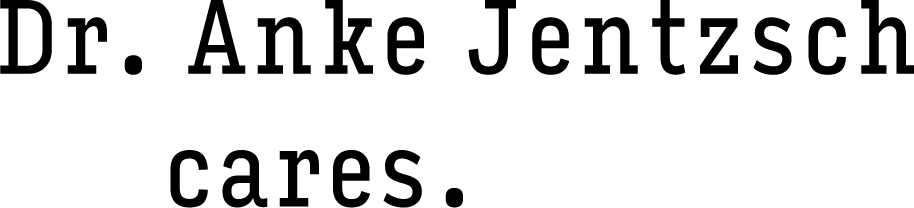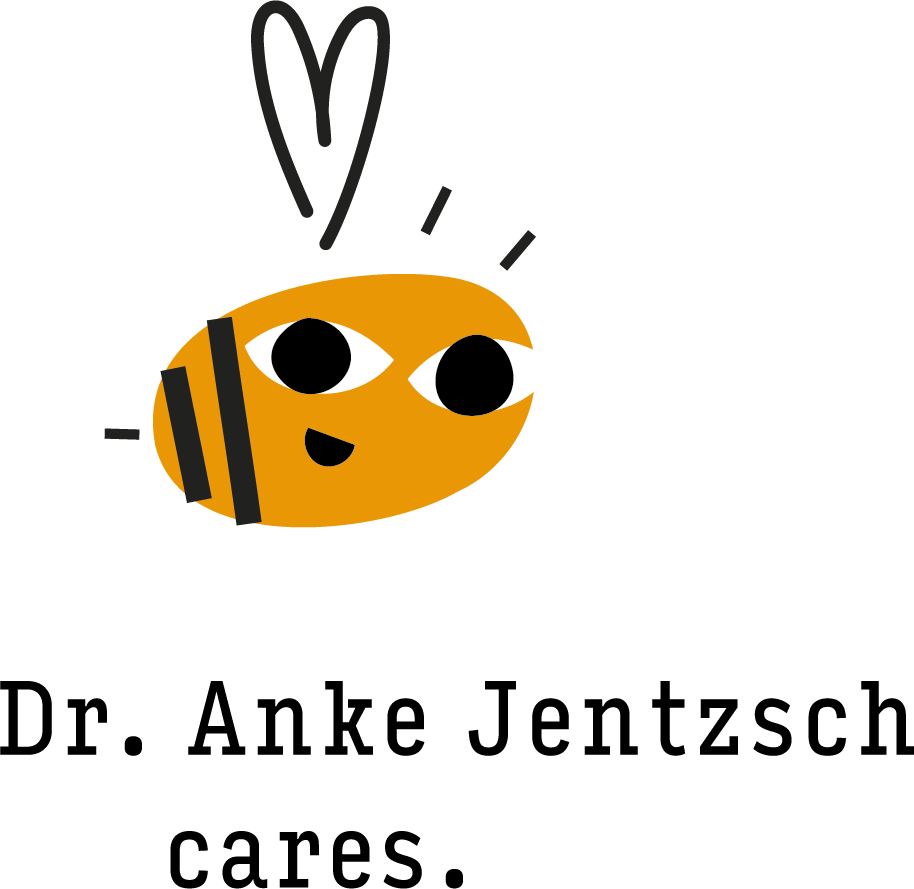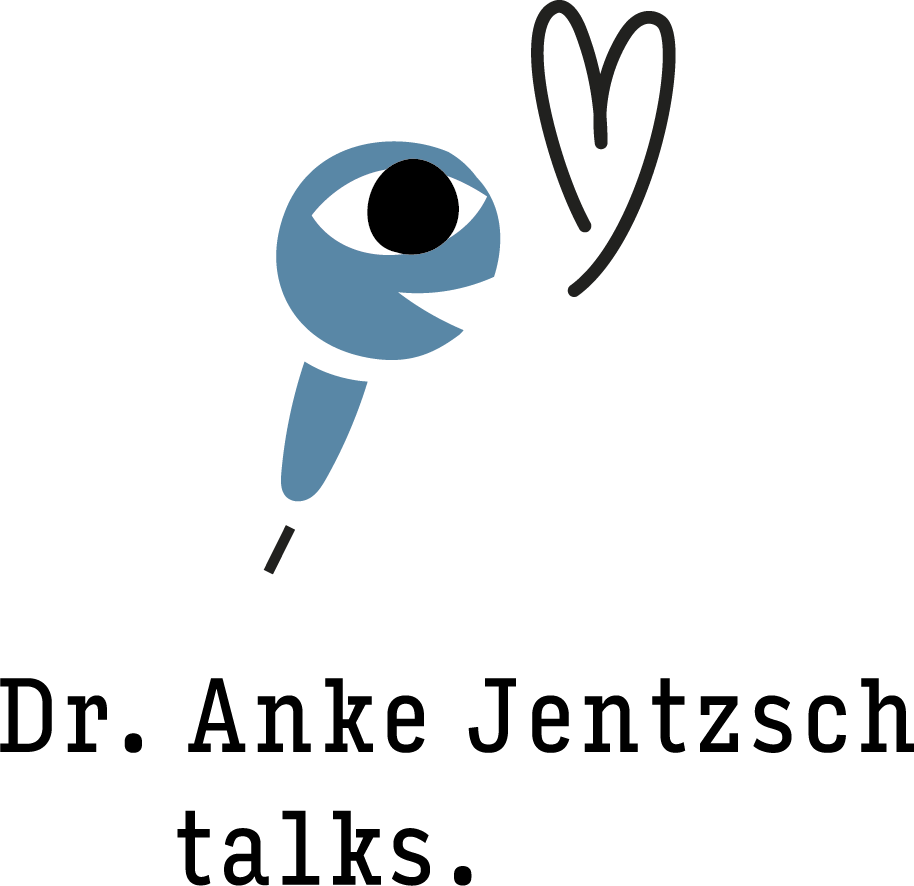Pflege ist mehr – vielfältig, fachlich stark und voller Verantwortung
Willkommen auf meinem Blog – einem Ort für Gedanken, Perspektiven und Impulse rund um das, was Pflege ausmacht.
Pflege ist weit mehr als ein Beruf. Sie ist Begegnung, Beziehung und Verantwortung. Sie ist geprägt von fachlicher Expertise, komplexen Anforderungen und einem tiefen menschlichen Auftrag: Die bestmögliche Versorgung und Begleitung der uns anvertrauten Menschen sicherzustellen.
Und genau darum geht es hier: um die Vielfältigkeit und Tiefe unseres Berufs. Um den Blick auf das, was Pflege leistet – jeden Tag, in unterschiedlichsten Settings und unter oftmals herausfordernden Bedingungen.
Ich bin überzeugt: Pflege muss sich weiterentwickeln dürfen – fachlich, strukturell und in ihrer Sichtbarkeit. Denn nur so können wir gemeinsam gestalten, statt zu verwalten. Nur so kann Pflege auch in Zukunft professionell, wirksam und menschlich bleiben.
In diesem Blog möchte ich regelmäßig über verschiedene Themen aus der Pflege schreiben – über aktuelle Entwicklungen, über fachliche Fragen, über gelingende Praxis und notwendige Veränderungen.
Lasst uns Pflege sichtbar machen – in all ihrer Vielfalt und Stärke.
Warum ich diesen Blog schreibe – und warum Pflege eine Bühne verdient
Pflege bewegt. Jeden Tag. Menschen, Gedanken, Strukturen – und nicht zuletzt mich selbst.
In den letzten Jahren durfte ich Pflege in ganz unterschiedlichen Facetten erleben: als Beruf, als Herausforderung, als Herzensanliegen. Ich habe Pflege gelehrt, entwickelt, begleitet, verteidigt und weitergedacht. Und ich habe gespürt: Es braucht Räume, in denen wir uns austauschen können. Offen, ehrlich, mit Fachverstand und Haltung.
Dieser Blog ist genau so ein Raum. Hier schreibe ich über das, was mir in meiner Arbeit begegnet: über gute Ideen und schwierige Prozesse, über Konzepte, die tragen – und solche, die scheitern dürfen. Ich teile Gedanken aus der Praxis, Impulse aus Coachings, Erfahrungen aus der Pflegeentwicklung und manchmal auch ganz persönliche Beobachtungen aus dem Alltag zwischen Theorie und Wirklichkeit.
Was ich mir wünsche? Dass dieser Blog inspiriert, Fragen aufwirft, zum Nachdenken anregt – und vielleicht auch den einen oder anderen Mut macht, die Dinge anders zu sehen oder neu anzugehen.
Pflege hat eine Stimme. Und ich freue mich, wenn du ihr hier mit mir zuhörst.
Herzlich
Dr. Anke Jentzsch

Meine Vision von Pflege
Pflege ist für mich mehr als Versorgung – sie ist ein zentraler Pfeiler unseres Gesundheitssystems, geprägt von hoher Fachlichkeit, Menschlichkeit und Verantwortung.
Ich sehe eine Pflege, die selbstbewusst handelt, fachlich fundiert entscheidet und aktiv an der Weiterentwicklung von Versorgung mitwirkt. Eine Pflege, die ihre Stimme erhebt – für Qualität, für Zusammenarbeit auf Augenhöhe und für die Menschen, die wir begleiten.
Meine Vision ist eine Pflege, die sichtbar ist, gehört wird und mitgestaltet – im Team, in der Organisation und in der Gesellschaft.
-
In meiner Masterarbeit habe ich mich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Achtsamkeit im pflegerischen Kontext verankert werden kann – nicht nur als persönliche Ressource, sondern als Bestandteil einer professionellen Haltung.
Dabei wurde deutlich: Achtsamkeit ist keine Methode, die man „mal eben“ in den Alltag integriert. Sie ist eine bewusste Form der Wahrnehmung, die sowohl Selbstreflexion als auch Beziehungsgestaltung stärkt – und genau hier liegt ihr Wert für die Pflege.
Pflegende agieren heute in einem hochkomplexen Spannungsfeld: zwischen Zeitdruck, organisatorischen Anforderungen, emotionaler Belastung und dem Anspruch, individuell und professionell zu handeln. Achtsamkeit kann in diesem Spannungsfeld Orientierung geben – sie ermöglicht es, innezuhalten, das eigene Handeln zu reflektieren und in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen und denen der Patient*innen zu bleiben.
Ein zentrales Ergebnis meiner Arbeit war: Achtsamkeit trägt zur Qualität der pflegerischen Beziehung bei. Sie fördert Präsenz, aktives Zuhören und eine zugewandte Haltung – Aspekte, die laut Forschung nachweislich Einfluss auf das subjektive Erleben von Fürsorge und Sicherheit bei Patient*innen haben.
Gleichzeitig wirkt Achtsamkeit gesundheitsfördernd für Pflegende selbst. Die Praxis der Achtsamkeit kann helfen, Überlastung frühzeitig zu erkennen, Stress konstruktiv zu regulieren und sich selbst in der Rolle professionell zu verorten – ohne sich dabei zu verlieren.
Aber – und auch das zeigt meine Arbeit: Achtsamkeit kann nicht allein dem Individuum überlassen werden. Sie braucht strukturelle Bedingungen, die sie ermöglichen. Eine Organisationskultur, die auf Beziehung und Menschlichkeit setzt. Führung, die achtsam kommuniziert. Und Räume, in denen Reflexion nicht als Luxus, sondern als Teil professionellen Handelns verstanden wird.
Meine Vision von Pflege ist eng verknüpft mit einer achtsamen Grundhaltung: Pflege, die präsent ist. Die sich selbst und das Gegenüber sieht. Die sich weiterentwickelt, ohne das Menschliche zu verlieren.
-
Die patientenorientierte Versorgung ist eines der großen Themen im Gesundheitswesen – oft genannt, selten konsequent gedacht. In meiner Dissertation habe ich mich genau diesem Spannungsfeld gewidmet: Wie gelingt ein Versorgungsprozess, der sich tatsächlich am Menschen orientiert – und nicht an Strukturen, Zuständigkeiten oder Routinen?
Im Zentrum meiner Arbeit stand die Frage, wie pflegerische Fachlichkeit zur Steuerung und Gestaltung patientenorientierter Versorgungsprozesse beitragen kann – insbesondere im Kontext komplexer, interdisziplinärer Versorgungssettings. Dabei ging es nicht nur um Modelle und Prozesse, sondern auch um Haltungen, Verantwortlichkeiten und das Zusammenspiel unterschiedlicher Berufsgruppen.
Ein zentrales Ergebnis meiner Forschung: Pflege hat das Potenzial, eine tragende Rolle in der Koordination patientenzentrierter Versorgung zu übernehmen – wenn sie als gleichwertige Profession anerkannt und in Entscheidungsprozesse aktiv eingebunden wird.
Was das bedeutet? Dass Pflege mehr ist als Ausführung. Dass Pflege sehen, denken, verbinden kann. Und dass genau diese Perspektive gebraucht wird, um Versorgung so zu gestalten, dass sie sich an den realen Bedarfen der Menschen orientiert – und nicht an den Grenzen des Systems.
Besonders wichtig war mir in der Arbeit die Verbindung von Theorie und Praxis. Denn wissenschaftliches Arbeiten darf sich nicht im Elfenbeinturm verlieren – es muss wirksam sein. Deshalb habe ich in meiner Dissertation nicht nur analysiert, sondern auch aufgezeigt, wie pflegerische Expertise konkret in Versorgungsprozesse eingebunden werden kann: durch neue Rollenprofile, partizipative Führungsmodelle und klare strukturelle Verankerung.
Was mich dabei besonders berührt hat: die Gespräche mit Menschen aus der Praxis, die täglich mit großem Engagement versuchen, Versorgung menschlich und professionell zugleich zu gestalten – oft gegen Widerstände, aber immer mit Haltung.
Diese Dissertation war nicht nur ein akademisches Projekt. Sie war auch ein persönliches Anliegen – ein Plädoyer für eine Pflege, die Verantwortung übernimmt, die mitdenkt, die gestaltet. Und für ein System, das das zulässt – oder es zumindest nicht verhindert.
In meinem Blog möchte ich immer wieder Themen aus der Dissertation aufgreifen – nicht wissenschaftlich abgehoben, sondern anschlussfähig für den Alltag: Wie können wir Versorgung neu denken? Was braucht Pflege, um wirksam zu werden? Und was bedeutet eigentlich „Patientenorientierung“ in einer Welt voller Checklisten und Zeitfenster?
Ich freue mich, diese Gedanken hier weiterzuführen – und gemeinsam mit euch ins Gespräch zu kommen.
-
Veränderung ist in der Altenhilfe allgegenwärtig – sei es durch Fachkräftemangel, neue Versorgungsanforderungen, Digitalisierung oder strukturelle Umbrüche. In meiner Bachelorarbeit habe ich mich deshalb mit einem Thema beschäftigt, das aktueller kaum sein könnte: Change Management in der Altenhilfe – mit Blick auf New Work und die Rolle der Mitarbeitenden im Wandel.
Ziel war es, zu verstehen, wie Veränderungsprozesse konkret erlebt werden – und was es braucht, damit aus organisatorischem Wandel auch tatsächliche Entwicklung entstehen kann.
Besonders spannend: Ich habe die Arbeit als anthropologische Beobachtung angelegt – also nicht nur analysiert, sondern mich vor Ort in den Alltag einer Einrichtung eingebracht und beobachtet, wie sich Veränderung „anfühlt“, wie sie kommuniziert wird – und wo sie ins Stocken gerät.Ein zentrales Ergebnis meiner Arbeit:
Ohne einen gut begleiteten Changeprozess bleibt New Work eine Worthülse. Denn: Neue Strukturen, neue Aufgabenverteilungen oder partizipative Elemente entfalten nur dann Wirkung, wenn die Mitarbeitenden in ihrer eigenen Rollenentwicklung ernst genommen und aktiv mitgenommen werden.Die Altenhilfe steht nicht nur vor der Aufgabe, Abläufe zu verändern – sie muss auch den Menschen in der Organisation Raum geben, ihre Rolle neu zu denken und zu finden. Und genau das gelingt nur, wenn Veränderung als gemeinsamer Prozess gestaltet wird – nicht als Top-down-Verordnung.
Veränderung braucht Vertrauen. Und sie braucht Führung, die zuhört, begleitet und Orientierung gibt – gerade in Phasen, in denen Sicherheit verloren geht.
New Work in der Altenhilfe ist deshalb mehr als Gleitzeit, flache Hierarchien oder digitale Tools. Es bedeutet, die Kultur der Zusammenarbeit zu hinterfragen, Verantwortung neu zu denken und mutig Strukturen aufzubrechen, die nicht mehr tragen.
Meine Bachelorarbeit war ein erster Schritt, diese Themen wissenschaftlich zu durchdringen – und sie zugleich in die Praxis rückzuspielen. Denn was ich beobachtet habe, gilt auch für mich: Pflege und Führung in der Altenhilfe brauchen keine revolutionären Konzepte, sondern echte Veränderungsbereitschaft – und Menschen, die Wandel nicht nur zulassen, sondern gestalten wollen.
In meinem Blog möchte ich genau hier weitermachen: Impulse geben, wie Change gelingen kann. Und zeigen, dass Wandel nicht Bedrohung, sondern Chance sein kann – wenn wir ihn bewusst gestalten.